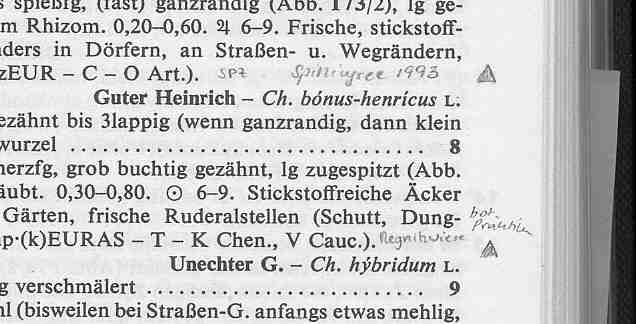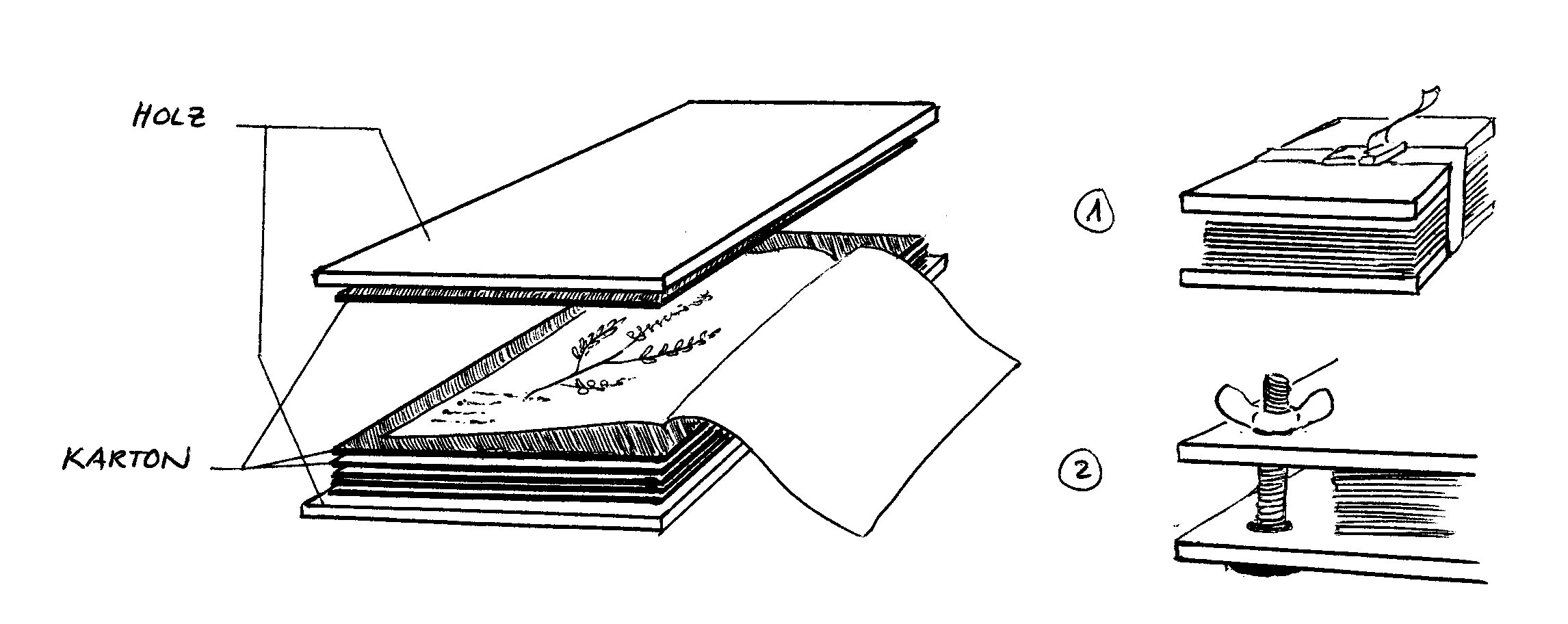Sammeln
von Pflanzen
Wer den Kamerabesitzern und
Blättchenabzupfern mit Verachtung jegliche reine Genußfähigkeit
abspricht, gehört zu einer Welt, die mit diesem Kapitel nichts
anfangen können wird. Es gibt aber Menschen mit einem mehr oder
weniger ausgeprägten Sammeltrieb, und daran ist nichts
Verwerfliches. Ihnen gelten die folgenden Zeilen.
Die
virtuelle Sammlung
Nicht jedem sind Ausdauer, Platz und
Zeit vergönnt, ein ganzes Herbarium anzulegen. Manchen ist auch
(zu Recht) der Gedanke zuwider, die letzte Orchidee zu pflücken,
um sie dann als plattgedrückte und ausbleichende Trophäe
vor Staubläusen und Museumskäfern schützen zu müssen.
Ein paar Anregungen, wie der Sammeltrieb anders gestillt werden
kann:
|
 Die platonische Sammlung
Die platonische Sammlung
Wer ein Bestimmungsbuch (in diesem Fall am besten einen
wissenschaftlichen Schlüssel) verwendet, kann durch kreative
Markierungen am Rand hervorheben, was er bereits irgendwo in
freier Wildbahn gesehen hat. Angaben über Fundort und -datum
erhöhen den Wert der „Sammlung“. Die Methode tut
der Natur nicht weh und nimmt - vom Buch abgesehen - keinen Platz
weg. Der wahre Sammler kann ergänzend Listen führen und
Statistiken über die Familienzugehörigkeit o.ä.
führen ...
|
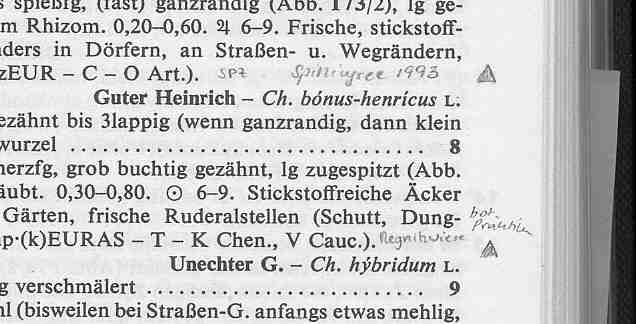
|
 Die Bildersammlung
Die Bildersammlung
Dias, Papierbilder oder auch
Bilddateien lassen sich gut sammeln. Bei der Wahl des Ablagesystems
ist darauf zu achten, daß die Sammlung noch bei großem
Umfang übersichtlich bleibt und ohne Probleme systematisch
richtig erweitert werden kann. Raum sollte auch für weitere
Bilder derselben Art oder Unterarten, Varietäten und Rassen
bleiben, die unweigerlich hinzukommen werden. Die
Sortiermöglichkeiten sind bei einer elektronischen Sammlung
sicher am größten, auch nimmt sie am wenigsten Platz in
Anspruch (vom PC abgesehen). Allerdings ist man damit wenig flexibel,
wenn es etwa darum geht, die Bilder einem größeren Kreis
oder gar unter freiem Himmel zu zeigen.
|
Beachtung verdient auch die Frage nach dem Sortierkriterium:
Deutsche Namen taugen nur bedingt, da viele Namen mehrfach
vergeben sind (Löwenzahn, Butterblume) oder nur regionale
Gültigkeit haben (Pissenlit). Nicht jeder mag aber ein rein
wissenschaftliches Alphabet anlegen, in dem er vielleicht lange
nach einem Gewächs suchen muß, dessen Name ihm dann
doch nicht so geläufig ist (Wer war gleich Mesembryanthemum
acinaciforme? Wie heißt nochmal der Heidegünsel auf
schlau?). Soll es ein Generalalphabet sein oder eine getrennte
Auflistung der einzelnen Familien?
|

|
Mir persönlich erscheinen eine
Vorsortierung in Familien und die Verwendung wissenschaftlicher Namen
(deutsch in Klammern dahinter, das hat man notfalls schnell
überflogen oder auf dem Bildschirm mit der „suche“-Funktion
aufgefunden) zweckmäßig.
|
Familie:
Lamiaceae (Lippenblütler)
Lamium amplexicaule
(Stengelumfassende Taubnessel)
Lamium maculatum (Gefleckte
T.)
Lamium purpureum (Purpurfarbene T.), dto: weiße
Form
Rosmarinus off. (Rosmarin)
Salvia glutinosa
(Kleb-Salbei)
Salvia officinalis (Echter Salbei)
Familie:
Menyanthaceae (Fieberkleegewächse)
Menyanthes
trifoliata (Fieberklee)
Familie: Orchidaceae
(Knabenkrautgewächse, Orchideen)
Orchis pallens
(Blasses Knabenkraut)
Vanilla planifolia (Echte Vanille,
Bourbon-Vanille)
|

|
Tip:
Von Blättern und sogar größeren Pflanzenteilen
läßt sich leicht ein schnelles Bild auf dem Scanner
machen
|
Das
klassische Herbarium
Eine Sammlung von
gepreßten Pflanzen kann als ästhetischer Genuß oder
auch als langweilier Stapel trockener Pflanzenleichen - und das
völlig unabhängig davon, ob sie von wissenschaftlichem Wert
ist.
 Die Auswahl
Die Auswahl
Man
sollte prinzipiell nichts pflücken, was am jeweiligen
Standort selten oder gar einzig ist. Der fachkundige Sammler kann
leichter einschätzen, was selten ist und was nicht - aber auch
er wird nie die letzten Exemplare einer Population entfernen.
Ansonsten ist alles herbarwürdig, was sich pressen oder
konservieren läßt, sofern es thematisch in die Sammlung
paßt. Angesichts von alleine in Deutschland ca. 3000 Arten
liegt es nahe, sich auf einen Bereich zu spezialisieren. Dies kann
eine Familie oder Ordnung sein, ein bestimmtes geographisches Gebiet,
ein Thema wie Wasser- und Sumpfpflanzen. Man kann auch Blätter
von Gehölzen herbarisieren oder sich andere, exotische Kriterien
ausdenken.
Gepflückt werden in der Regel zusammenhängende
Pflanzenteile, die alle wichtigen Merkmale der Pflanze zeigen.
Idealerweise ist dies ein vollständiges Exemplar mit Blüte,
Früchten und Wurzel. Fast nie können Blüte und Frucht
gleichzeitig geerntet werden, die Wurzel ist entweder zu fest im
Boden oder zu dick oder schmutzig, und spätestens bei großen
Laubbäumen müssen Konzessionen gemacht werden. Manche
Sammler knicken größere Pflanzen mehrfach, um sie auf
Herbarformat zu bekommen, andere wählen geeignete Abschnitte.
 Das Pressen
Das Pressen
Die
Pflanzenpresse ist das wichtigste Handwerkszeug.
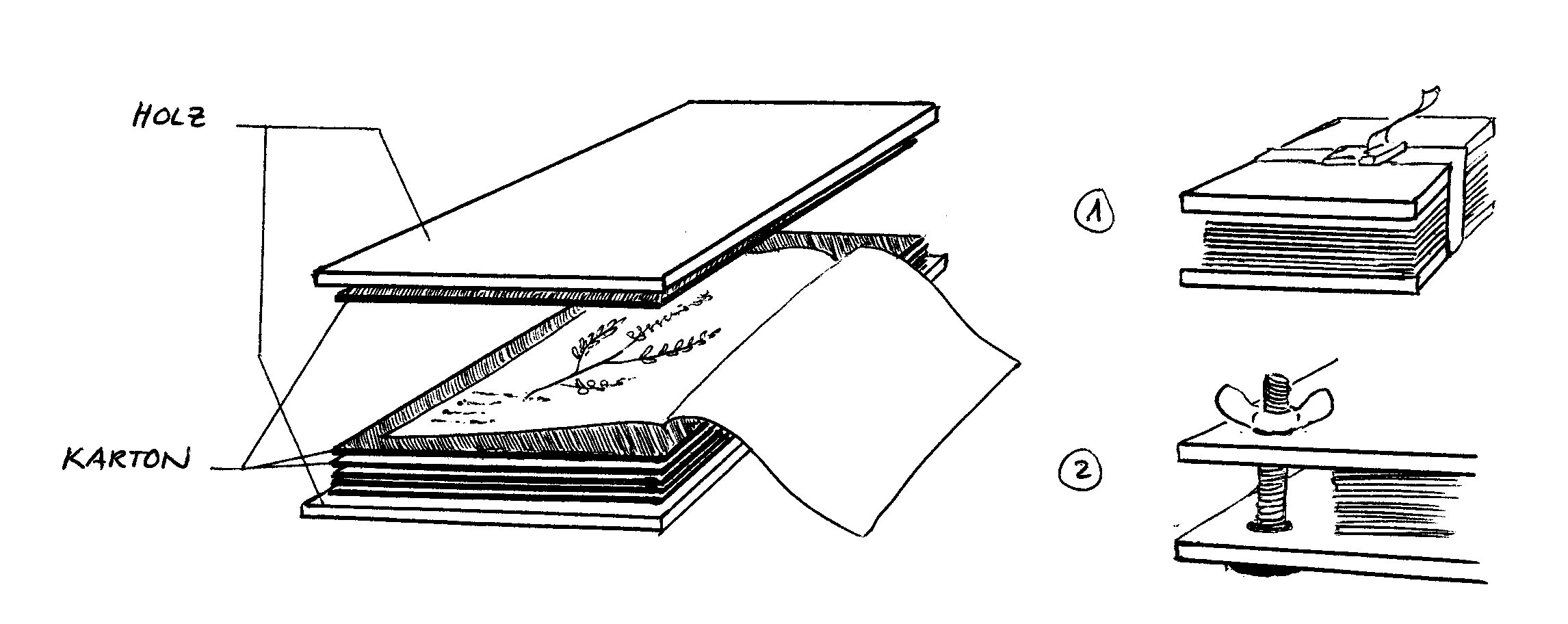
Die
Pflanze wird in möglichst natürlicher Lage zwischen
Zeitungspapier (oder andere, saugfähige Bögen) gelegt und
zwischen den Pappdeckeln der Presse für ein paar Wochen unter
Druck gepreßt. Vor dem Einlegen müssen unbedingt die
Pflanze genau bestimmt und Fundort, Datum und Name auf dem Papier
notiert werden. Die Bestimmung von gepreßten Pflanzen ist
ungleich schwieriger.
Die Presse kann leicht selber gebaut werden.
Für den Druck sorgen wahlweise Packriemen (wie sie für
outdoor-Zwecke angeboten werden) oder Schrauben mit Flügelmuttern
in vier dafür an den Ecken gebohrten Löchern.
Pressen
in Büchern ist nur ein Notbehelf, denn entweder öffnet man
das Buch arglos vorzeitig oder öffnet es erst nach 20 Jahren
wieder oder würde es gerne öffnen, obwohl es noch für
zwei Wochen mit Grünzeug belegt ist. Und hinterher hat es grüne
Flecken.
 Das schöne Herbarium
Das schöne Herbarium

Hier werden vor allem bunt
blühende Gewächse Eingang finden, die sich ansehnlich
arrangieren lassen. Die Sammluing schreit nicht nach Vollständigkeit
und kann daher auf ähnliche, aber geschützte bzw. seltene
Exemplare ebensogut verzichten wie auf Gewächse, die zum Pressen
einfach zu dick, hart, spröde oder einfach unattraktiv
erscheinen. Auch Wurzeln können gut fehlen, und auf die Form der
abgefallenen Kelchblätter kommt es nicht an.
Auf eine
saubere Beschriftung (Name, nach Möglichkeit auch der
wissenschaftliche; Fundort und -datum gehören dazu) sollte man
auch hier nicht verzichten.
Für die Ablage
kommen viele Varianten in Frage, die die Sammlung präsentabel
und transportabel gestalten:
- Grundlage wird immer weißes
Papier sein. Farbige oder gar gemusterte Bögen stören den
Gesamteindruck und konkurrieren mit den Farben der Pflanzen.
-
Aufkleben mit gummierten Papierstreifen (selbstklebende Streifen
altern!) auf weißes Papier. Sehr schonende Methode, aber nicht
gerade robust.
- Aufkleben mit Klebestift. Erfordert einiges
Geschick, um die Pflanze nicht zu zerstören. Hält sehr gut
und kann faszinierend aussehen, allerdings gehen die Details der
Unterseite unweigerlich verloren.
- Die Herbarbögen können
in einer Mappe liegen oder auch einzeln in Klarsichthüllen
(Prospekthüllen). Letzteres bringt allerdings einen erheblichen
Berg Plastikmüll mit sich. Außerdem müssen die
Pflanzen vorher restlos trocken sein, damit nichts schimmelt.
-
Von der (wegen der Unzerstörbarkeit leider häufig
praktizierten) Methode, die Pflanze mit Buchfolie aufzukleben, muß
gewarnt werden. Abgesehen davon, daß die Pflanze bis zur
Unkenntlichkeit verpappt wird und die Sammlung zu 50% aus
Plastikfolie und Klebstoff besteht, verschimmelt sie nahezu immer
innerhalb kurzer Zeit.
- Statt weißer Bögen
kann auch ein weißes Heft oder Buch verwendet werden,
allerdings läßt sich die Reihenfolge der Sammlung hier nie
mehr verändern.
- Niemals aus Sparsamkeit Pflanzen auf
Vorder- und Rückseite der Heftseiten kleben - sie verhaken sich
beim Umblättern oder scheuern gegeneinander und gehen schnell
kaputt.
 Die wissenschaftliche Sammlung
Die wissenschaftliche Sammlung
Hier finden sich aus
Gründen systematischer Vollständigkeit auch Gewächse,
die nicht so spektakulär aussehen, obwohl sie es für den
Botaniker durchaus sein können. Die Erkennbarkeit typischer
Merkmale (Fruchtform? Unterschied von Grund- und Hochblättern?
Behaarung?) ist hier von großer Bedeutung. Soweit möglich,
sollten alle wichtige Teile vorhanden sein - von der Wurzel bis zum
Sproßende. Auf eine exakte Beschriftung kommt es hier in
besonderem Maße an:
- Wissenschaftlicher Name
(sinnvollerweise ergänzt durch den deutschen Namen und die
Familie)
- Fundort
- Funddatum
- Hinweise auf evtl.
verlorengegangene Details (Blütenfarbe, abgefallene
Kelchblätter)
- Name des Finders (sofern nicht in der ganzen
Sammlung einheitlich)
Die beste Ablageform ist der gefaltete
Papierbogen (mindestens A3 gefaltet), in dem die Pflanze locker
liegt. Alle Details können jederzeit untersucht werden. Das
Problem alternder Klebstoffe besteht nicht. Solche Sammlungen
überstehen Jahrhunderte. Von Nachteil ist, daß die Bögen
praktisch nicht anders als waagerecht und vorsichtig transportiert
werden können.
Eine behutsame Fixierung mit gummierten
Papierstreifen (Tesafilm altert klebrig und dunkel und zieht ins
Papier ein!) über weniger wichtigen Stengelteilen ist möglich;
so eine Sammlung kann auch auf einzelnen (ungefalteten) Bögen -
z.B. in einer Mappe - aufbewahrt werden.
 zurück zur Startseite
zurück zur Startseite
![]() Die platonische Sammlung
Die platonische Sammlung